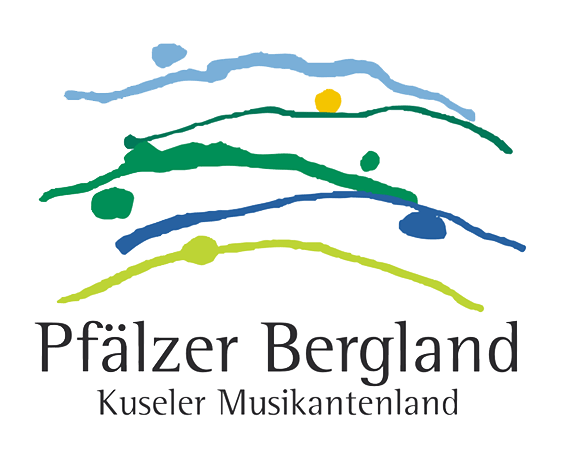.… und Westen war der Bergfried umgeben von Wohnbauten, die sich an der Ringmauer anlehnten und nur die nordöstliche hohe Wehrmauer frei liessen. Der verbleibende Hofraum und den Bergfried schied sich in einen äusseren nordöstlichen und einen inneren südwestlichen Teil. Im äusseren Hof lag im östlichen spitzen Winkel der runde Burgbrunnen, oder vielmehr eine Zisterne von 4,75 m Tiefe und unten von 2 m Durchmesser. Im nördlichen Winkel befand sich neben dem spitzbogigen Einfahrtstor im runden Treppenturm des Pfärtnerhauses der Aufgang zum Wehrgange, der aussen auf einem Spitzbogenfries mit Doppelkonsolen vorkragte. Die Wohnbauten an der Ringmauer haben zum Teil Keller, die noch vorhanden, aber verschüttet sind. Sie verraten sich an der Aussenseite durch kleine Lichtschlitze in der Stützmauer. Der Zugang zum äusseren Burghof liegt in der Nordwestecke und war überbaut mit dem hohen, dreistöckigen Pförtnerhause, von dessen drittem Stock eine Brücke zu dem oberen Eingang in den Bergfried führte. Bei der letzten Instandsetzung des Bergfrieds im Jahre 1909 wurde dieser Eingang, der 1896 zugemauert war, wieder geöffnet und mit einer Brüstung versehen. Die Sicherung der gefahrdrohenden hohen Mauerpfeiler dieses turmartigen Pförtnerhauses steht noch aus.
Von der Oberburg aus ist die Burg allmählich vergrössert worden, Zuerst wurde im Osten, Süden und Westen um die Ringmauer herum zur Sicherung des Burgweges ein Zwinger angelegt, gleichzeitig mit dem inneren grossen, 27 m breiten Halsgraben, der das ganze westliche Ende der Landzunge von dem östlichen Bergrücken abschneidet und im Zuge des Burgweges mit einer Brücke überspannt war. Die Brücke war im westlichen Drittel als Zugbrücke hergestellt und durch einen Torbau gedeckt, von dem vor den letzten Instandsetzungen (1905 bis 1909) nur noch geringe Reste der Torpfeiler vorhanden waren. Nach den deutlichen Spuren an der benachbarten Giebelwand der sogenannten Landschreiberei konnte aber der ganze Torbau wieder hergestellt werden, was nach dem Wiederaufbau der Landschreiberei, die auf Kosten des Kreises erfolgte, eine Notwendigkeit war.
Dies letzte Gebäude gehört vermutlich einer zweiten Erweiterung an, während vorher der Torhüter auf der Nordseite des Tores im neuen Zwinger seinen Unterkunftsraum hatte.
Zu dieser Erweiterung, die wegen ihrer Grossartigkeit wohl in das 15. Jahrhundert nach dem Uebergang der Burg in den Besitz der Pfalzgrafen von Zweibrücken zu setzen ist, gehörte die Anlage des grossen Zwingers, der im Anschluss an den inneren großen halsgraben von der Nordseite angelegt und mit drei sehr starken runden Aussentürmen verstärkt wurde. Er erstreckte sich auf der Nordseite bis zur Grenze des neutralen Gebietes, das zwischen der Oberburg und der Niederburg lag und nach Osten durch die jetzige evangelische Kirche begrenzt wird. Im Süden sind die Gebiete beider Burgen durch eine ohne erkennbare Grenze durchgeführte Stützmauer gleichmässig umschlossen. Den Anlass zu dieser zweiten bedeutenden Erweiterung gab wahrscheinlich die Errichtung der zwei grossen Pallasgebäude auf der Nord- .…. Fortsetzung folgt.
Quelle:
Recherche Rauch, Burgverwaltung Lichtenberg
Burg Lichtenberg – die Veste und Ihre Erhaltung von Regierungs- und Baurat von Behr 1910