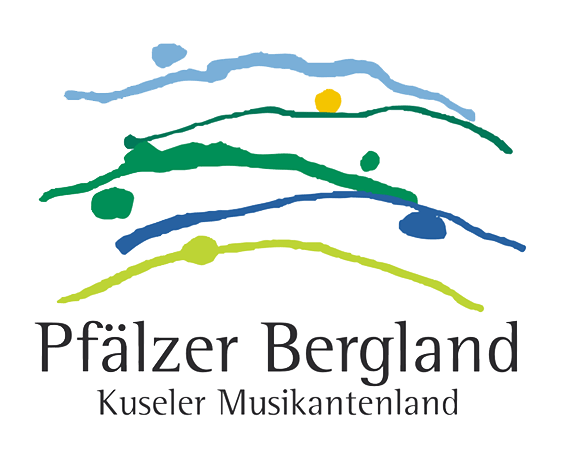…… Bergfried ist mit den vier Ecken nach den Himmelsrichtungen orientiert und hat bei quadratischer Grundform rund 11 m Aussenseite einen lichten Innenraum von 6 m Seiten- und 2-3 m Mauerstärke. Jetzt hat er – ausser dem neu angelegten unteren Eingang und dem bei der Instandsetzung im Jahre 1896 wiederhergestellten alten oberen Zugang an der Nordwestseite – gar keine Lichtöffnungen. Auf einem alten Lichtbilde, welches den Zustand vor jener Instandsetzung darstellt, erkennt man in dem jetzt nicht mehr vorhandenen oberen Teil der Umfassungsmauern auf jeder Seite grössere rechteckige Öffnungen. Wahrscheinlich aber haben an der Stelle der grossen Breschen, welche das alte Bild zeigt, sich ursprünglich. Schmale Lichtschlitze befunden, die bei der Zumauerung der Breschen nicht hergestellt wurden, da man für ihre Form keinen Anhalt fand. Auch sind damals wohl die Balkenlöcher zugemauert worden, welche die Lage der Geschosse erkennen liessen. Auffallend und das Zeichen früherer Bauzeit ist das Fehlen eines Gewölbes. Über dem untersten Raume, in ca. 3 m Höhe über dem gewachsenen Felsboden, ist ein Maueransatz von 50 cm für eine Balkenlage. Im Osten, Süden …..
.…. Fortsetzung folgt.
Quelle:
Recherche Rauch, Burgverwaltung Lichtenberg
Burg Lichtenberg – die Veste und Ihre Erhaltung von Regierungs- und Baurat von Behr 1910

Die erste reformierte Kirche über der südlichen Torfahrt der Unterburg war 1759 wegen Baufälligkeit abgebrochen worden und 1871 und 1835 zur Schule eingerichtete Landschreiberei, 1874 war das reformierte Schulhaus, westlich neben der jetzigen Kirche einem Brande zum Opfer gefallen.
Die grossen Abbrüche erfolgten zu einer Zeit, als das Fürstentum Lichtenberg bereits (seit 1834) in den Preussischen Staatsverband und Besitz übergegangen war, aber die Burg Lichtenberg, welche unter der Koburgischen Regierung (1816 – 1834) in einzelnen Parzellen auf Abbruch verkauft worden war, sich im Besitze von Privatleuten befand, die ihr gutes Recht des Abbruches gewissenhaft ausübten. Zum Glücke war bei der Abbruchsversteigerung der besterhaltenste und wertvollste Teil der Oberburg mit dem Bergfried in die Hände eines Kuseler Bürgers Binger gekommen, der im Jahre 1892 der Preussischen Regierung seiner Anteil verkaufte. Gleichzeit beginnen nun auch schon die Instandsetzungsarbeiten.
- Beschreibung
Den Kern der Burg bildet die vom hohen Bergfried überragte Oberburg an der höchsten Stelle des Bergrückens. Ihr kleiner Bering wird umschlossen von einer unregelmässigen geführten Ringmauer, die nach Norden noch über 8 m hoch erhalten ist im Süden her kaum noch Brüstungshöhe über dem Fussboden des Burghofes besitzt. Der 18 – 20 m hohe……
. .…. Fortsetzung folgt.
Quelle:
Recherche Rauch, Burgverwaltung Lichtenberg
Burg Lichtenberg – die Veste und Ihre Erhaltung von Regierungs- und Baurat von Behr 1910

Haarbeck erwähnt, dass vorübergehend im 18. Jahrhundert jeden Sonntag drei verschiedene Gottesdienste für Reformierte, für Lutherische und für Katholiken auf Burg Lichtenberg gehalten wurden. Die katholische St. Georgskapelle war für kurze Zeit wiederhergestellt worden.
Im Laufe der Zeit hatte die Burg sich immer mehr ausgedehnt. Innerhalb der weit gezogenen Ringmauern, die nahezu vier Hektar umschlossen, hatte sich eine zahlreiche Bevölkerung angesiedelt: Familien der Burgbeamten, aber auch solche Familien, die in näherem Verhältnis zur Herrschaft standen, ohne Beamteneigenschaften zu haben.
Es ist deshalb erklärlich, dass heute überall auf der Burg sich Reste von Baulichkeiten finden, die nicht mit burglichen Zweck in Einklang gebracht werden können.
Die kriegerischen Verwicklungen des 17. Jahrhunderts hat die Burg noch gut überstanden. Im Jahre 1620, als die Spanier durch die Gegend zogen, wurde die Burg auf der Ostseite mit einem neuen Werke versehen, die alten Befestigen wurden eiligst wieder hergestellt. Im Jahre 1677 (Haarbeck a.a. O. S. 40) heisst es: „Die herrschaftlichen Gebäude waren im Jahre 1661 sehr mangelhaft, sind aber fast durchgehends neu gedeckt und sonsten mit grossen Kosten repariert worden“. Im Jahre 1693 heisst das Herrenhaus „in schlechtem Zustande und mehrentheilss ruinos“. In einem amtlichen Bericht des Kammerdirektors O.H. Webel vom Jahre 1704 heisst es noch: „Das Schloss Lichtenberg ist ein gutes Berghauss, darinnen ein hoher steinerner Turm, ein Hauss mit etlichen zimmern sampt einer Wohnung vor einen Keller, so a parte mit noch ziemlichen Mauern umbgeben, davon etliche gegen das Tal etwas baufällig. Die Täücher uff beiden seind ziemlich baufällig und were fast nöthig, dass mann beydte neu machen liesse, weil das Flickwerk nicht mehr halten will, so auch wegen nöthiger Speicher daselbsten nicht wohl unterbleiben kann. Ausser dem Schloss stehet (die?) gleichfallss mit Mauern umbgebene Burg, das Amptshauss, so der Amptsverweser bewont, und Landschreyberey Hauss, so der Keller jetzt inne hat; sind beide auch baufällig“. (Haarbeck S. 41.) Aber noch das ganze 18. Jahrhundert hindurch stand die Burg und war bewohnt und in Betrieb. Erst ein grosser Brand um 1895, der die Zehntscheune und alle östlich anstossenden Gebäude einschliesslich des Pallas vernichtete, hat wahrscheinlich eine derartige Zertrümmerung der wichtigsten Werksteinkonstruktion herbeigeführt, dass es nicht mehr vieler Nachhülfe friedlicher Zerstörer bedurfte, um den heutigen trostlosen Zustand der Burg zu schaffen.
Auch bestätigt Haarbeck durch die Mitteilung der im 19. Jahrhundert erfolgten Abbrüche die rasch fortschreitende Zerstörung der vom grossen Brande noch übrig gebliebenen Reste. Im Jahre 1804 ist die Schäferei am nördlichen Berghange niedergelegt, von der noch einige trämmerhafte Mauerreste den Standort verraten; 1839 wurde das herrschaftliche Haus der Blicke und Günderode (Nordostecke der Unterburg), 1842 der Pferdestall im Westen der unteren Burg, 1850 das vierte Tor in der Südmauer des vorderen Burghofes der Oberburg, 1887 die Südmauer des Saales und der Altar im östlichen Pallas abgebrochen…..
.…. Fortsetzung folgt.
Quelle:
Recherche Rauch, Burgverwaltung Lichtenberg
Burg Lichtenberg – die Veste und Ihre Erhaltung von Regierungs- und Baurat von Behr 1910

Termin: Samstag und Sonntag 19. und 20. Juli 2025 von 09.00– 18.00 Uhr
Kosten: 249 € pro Person
Teilnehmer/innen: Frauen und Männer, sowie Jugendliche ab 16 Jahren ( bzw. 14 Jahren mit Begleitperson) maximal 10 Personen
Leistungen: Bereitstellung aller Materialien und der notwendigen Werkzeuge.
Die Rohlinge die vorhanden sind: englischer Langbogen, Normannen, Alemannen, Holmegard und Bambus als moderner laminierter Bogen sowie drei Pfeile.
Der Kurs findet im Freien statt.
Die Teilnahme ist auf 10 Personen begrenzt.
Beschreibung: Die Erfindung des Bogens ist für die Menschheit ein großer Fortschritt gewesen; er konnte aus der Entfernung lautlos Wild erlegen oder aus sicherem Abstand seine Habe verteidigen.
Bis vor etwa 500 Jahren wurde der Bogen noch alltäglich für diese Zwecke in unseren Breiten eingesetzt, heute dient er noch für die Jagd und zum Sport denn es ist immer noch eine physische und psychische Herausforderung einen Pfeil ins Ziel zu setzen.
An den zwei Tagen des Seminars stellen wir einen gebrauchsfertigen Bogen nach historischen Vorbildern her, zum Beispiel einen steinzeitl. Holmegard Bogen od. mittelalterlicher Wikinger- und englischer Langbogen. Moderner sind Bambusbögen die auch angeboten werden.
Als Bogenholz wird Hickory verwendet.
Drei Pfeile mit Befiederung und die Sehne vervollständigen die Ausrüstung, die dann auch im Probeschießen getestet werden kann.
Zu der fachkundigen und handwerklichen Anleitungen werden während des Seminars auch allgemeinverständliche Hintergrundinformationen vermittelt.
Neben der Freude an handwerkliche Arbeit hat jeder/r Teilnehmer/in die Möglichkeit, einen Bogen herzustellen, der, was Größe, Zuggewicht und den Endschliff angeht, speziell auf Ihn/sie persönlich zugeschgnitten ist.
Für sein leibliches Wohl muß allerdings Jede/r selbst sorgen.
Anmeldung und Auskunft:
Verwaltung Burg Lichtenberg
Telefon 06381 8429 (bitte erst ab 12.00 Uhr)
E-Mail: burg-lichtenberg@kv-kus.de

Dies Geschlecht war nun 200 Jahre lang im Besitze der Burg. Eine Urkunde aus dem Jahre 1364 (Acta acad. Palat. IV, p. 333) nennt wieder ausdrücklich die Unterburg: sie bekundet, dass Graf Heinrich II. von Veldenz seiner Schwiegertochter, der Gräfin Loretta von Sponheim, wahrscheinlich Tochter der bekannten glücklichen Gegnerin des grossen Erzbischofs Balduin von Trier (1308-1354) und Besitzerin der Gräfinburg bei Trarbach, die untere Burg Lichtenberg zur Wohnung als Witwensitz bestimmt.
Unter Stephan von Pfalz-Zweibrücken (1410-1459) gelangte die Burg im Wege der Erbfolge in den Besitz dieses pfalzgräflichen, später herzoglichen Hauses, bei dem es bis zur französischen Revolution verblieb. Die Erbschaftsverhandlungen über die sogenannte Sponheimer Erbschaft werden u.a. durch eine Urkunde aus dem Jahre 1426 beleuchtet. Als im 17. Jahrhundert eine Linie des pfälzischen Hauses auf den schwedischen Königsthron gelangte, stand vorübergehend die Burg auch unter schwedischer Oberhoheit.
Aus der Zweibrückenschen Zeit werden mehrere kriegerische Schicksale der Burg berichtet, die auf die Bedeutung als wichtiger Verteidigungspunkt und die Art ihrer Ausrüstung einiges Licht werden, ohne dass wir jedoch bestimmte Kunde über die Geschichte ihres Ausbaues und ihre allmähliche Erweiterung, die schliesslich zu einer völligen Verschmelzung der zwei anfangs getrennten Burgen führte, erhalten.
Da die Burg ursprünglich kurpfälzisches Lehen war, entstanden später Zwistigkeiten in der Familie des pfalzgräflichen Hauses selbst, die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu einem Kriege zwischen Ludwig I. (1459-1489), dem Verwalter des Veldenzer Gebietes, und seinem Vetter Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz führten. Die aus dieser Zeit stammenden Urkunden ergeben die Bundesgenossenschaft des Erzbischofs Diether von Mainz für den bekämpften Pfalzgrafen in Lichtenberg.
Für die Baugeschichte ist von Interesse, dass 1488 eine Rossmühle auf Lichtenberg angelegt ist. Solche Mühlen verband man gern mit der Anlage der grossen runden Bastionen, die nach Einführung der Feuerwaffen üblich wurden, und in dem untersten Raume wegen ihrer Kreisform und der grossen Sicherheit gegen Geschosse dafür sehr geeignet waren. Es kann damit die Anlage der grossen nördlichen Bastion zwischen dem westlichen und östlichen….. Fortsetzung folgt.
Quelle:
Recherche Rauch, Burgverwaltung Lichtenberg
Burg Lichtenberg – die Veste und Ihre Erhaltung von Regierungs- und Baurat von Behr 1910