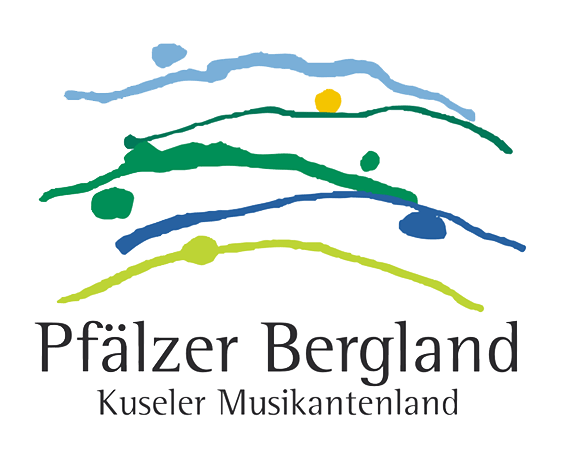… schon damals beraubt worden, mit Ausnahme des Kellers, des Eckturmes und eines Teiles der Umfassungswände, in denen noch eine Spitzbogentür und gotische Fenstereinfassungen verblieben waren. Diese Teile wurden sorgfältig geschont und im übrigen der Wiederherstellung eine alte Zeichnung zu Grunde gelegt, die das Haus vor dem Brande darstellte. Im Anschlusse an dies Haus wurde das an dem Nordgiebel dieses Hauses angebaute dritte innerste Tor hergestellt und nach den an der Giebelwand deutlich erkennbaren Ansatzspuren mit dem ehemaligen Fachwerküberbau versehen.
Auch das zweite, mittlere Tor, das nur aus einem Spitzbogen mit Wehrgang darüber bestand, wurde im Bestande gesichert und das runde Ecktürmchen, das den Abschluss der Wehrmauer nach der südlichen Zwingenanlage bildete, mit einem einfachen spitzen Helmdache versehen. So war, das das erstere (das Aussentor) bereits 1899 mit einem Schutzdache versehen und später im Innern ausgebessert war, die ganze dreifache Toranlage gesichert.
Am meisten Kosten erforderte aber die Ausheilung der sehr grossen Breschen in den massiven Umfassungswänden der östlichen Hufeisenbastion von 1620, in dem Mauerwerk der Brücke, welche aus der Bastion über den äusseren Halsgraben führte., und bei den Gebäuden der Oberburg. Von den letzteren wurde vor allem die hohe Nordmauer der beiden Pallasbauten nach aussen gesichert., die Fenstergewände und das Hauptgesims ergänzt, der hohe Giebel des östlichen Pallas, in dem sich die Altarnische befindet, standfähig gemacht und die letztere selbst ausgebessert.
Der Bergfried, dessen grosse Breschen schon bald nach der Erwerbung der Ruine durch den preussischen Fiskus 1894 ausgeheilt waren, wurde zum grössten Teil von den im Innern lagernden Schuttmassen befreit und auf Kosten des Kreises durch eine Treppe bis zur Krone der fast 2 m starken Umfassungsmauern besteigbar gemacht. Der gerade Abschluss der Brüstung ist nur ein vorübergehender Zustand. Nach dem noch vorhandenen alten Bilde des Turmes soll, sobald die Mittel dazu aufgebracht sind, auch das oberste Geschoss mit den rechteckigen Luckenöffnungen wiederhergestellt und ein einfaches hohes Schutzdach aufgebracht werden.
Die nördlichen Wehrmauer des obersten Burghofes und der sehr zerklüftete Treppenturm sind gleichzeitig gesichert und letzterer mit einem flachbogigen Zugangs versehen. In ähnlicher Weise wurde der westliche Pallas mit der anschliessenden westlichen Wehrmauer und dem runden Eckturm gefestigt.
…. Fortsetzung folgt.
Quelle:
Recherche Rauch, Burgverwaltung Lichtenberg
Burg Lichtenberg – die Veste und Ihre Erhaltung von Regierungs- und Baurat von Behr 1910