





2024 erhielt der Landkreis Kusel aus dem Nachlass des Sammlers Wolfgang Haiduk, Schönenberg-Kübelberg ein sogenannter „Schüsselpfennig“ des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken aus der Zeit Ludwig des I. (*1424 +1489). Burg Lichtenberg stand von 1459 – 1489 in dessen Herrschaft.
Der Durchmesser der Münze beträgt ca. 1,5 cm, die Materialstärke ca 0,25 mm.
Schüsselpfennige wurden aus einem besonders dünnen Blech (zumeist Silber, Billon, Kupfer oder Gold) hergestellt.
In der Regel sind sie wegen der Dünne ihres Metallblechs nur einseitig geprägt.
Der Schüsselpfennig diente im frühen 14. Jahrhundert vor allem in Südwestdeutschland und Teilen der Schweiz tatsächlich als Zahlungsmittel. Seinen Namen verdankt er seiner für Münzen doch sehr unüblichen Formgebung, die an eine kleine Schüssel erinnerte. Dass der Schüsselpfennig zum Rand hin leicht teller- oder eben schüsselartige gewölbt ist, liegt daran, dass er mit einem Münzstempel geprägt wurde, dessen Durchmesser kleiner als der Durchmesser des verwendeten Schrötlings (Rohmünze) war.
„Unser“ Schüsselpfenig ist ein typischer Vertreter dieser Münzart. Aufgrund der Dünne des Materials ist auf einer Seite die Prägung klar zu erkennen, die sich auf der Rückseite quasi als Negativ durchschlägt.
Quelle:
Recherche Andreas Rauch, Burgverwaltung Lichtenberg/Pfalz
btn-muenzen.de/muenz-ratgeber/muenz-lexikon/schuesselpfennig/
Münzhandlung Reppa ,Pirmasens
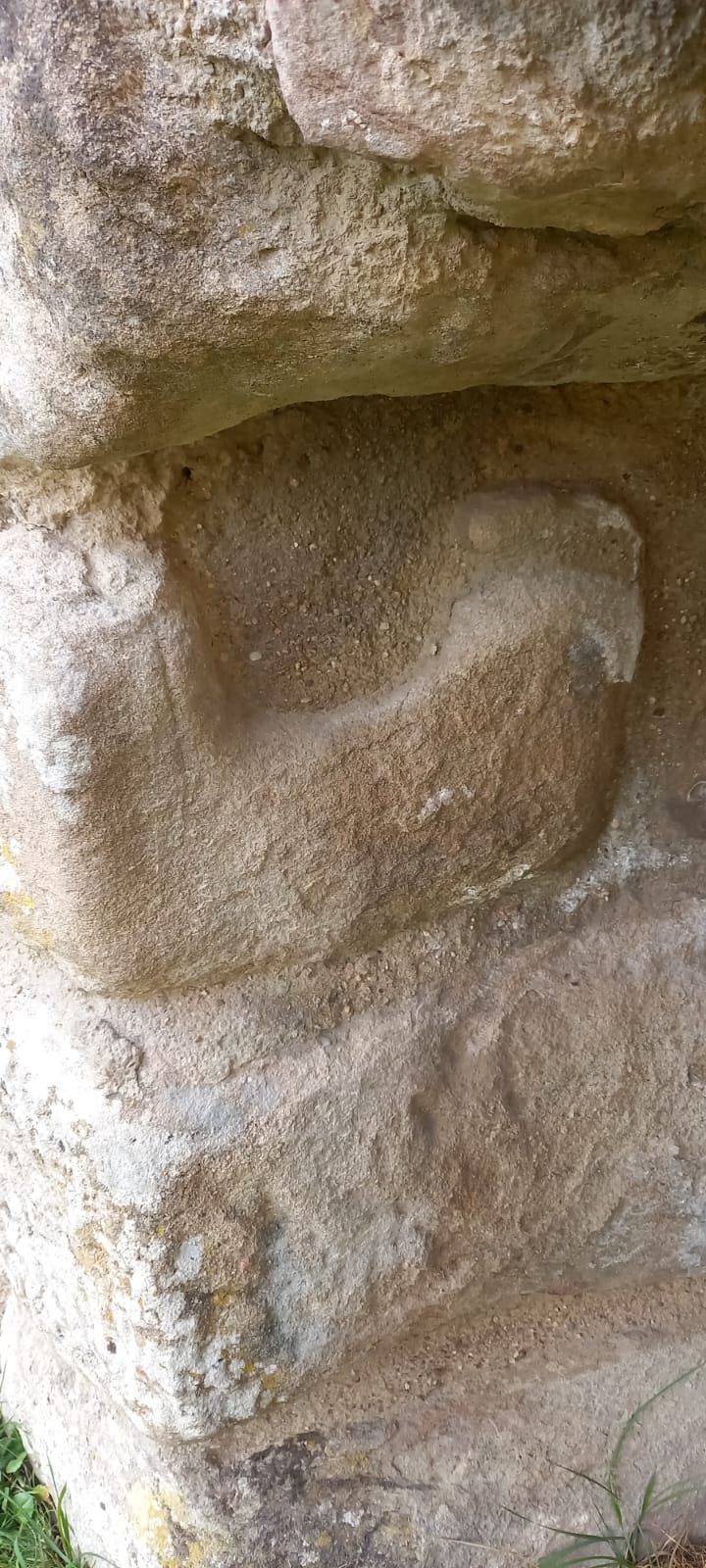
Auf der Nordseite der „Oberburg“ stehen noch die imposanten Aussenmauern des „Westpalas“. Gerne als Fotokulisse genommen fallen dem aufmerksamen Betrachter auch Kleinigkeiten in der Baustruktur auf, welche über die Entstehung des Baues Aufschluss geben.
Aber Eins nach dem Anderen:
Auf heutiger Bodenhöhe befinden sich 4 fensterartige Öffnungen welche früher höher lagen und durch die Tageslicht in das Erdgeschoss des Palas hereinfiel.
In den Vorderen und Hinteren oberen Ecken sind mehr oder minder gut zukennende Aussparungen in den dort gesetzten Steinquadern welche zum zum Teil vermauert wurden aber auch durch den Zahn der Zeit einfach abgeschliffen sind.
Doch welchen Zweck erfüllten sie?
Wahrscheinlich handelt es sich um eine Balkenauflage für eine Gewölbelehre um so das kleine Tonnengewölbe über den Öffnungen mauern zu können. Übrigens eine Technik die ja heute auch noch eingesetzt wird.
Ist Ihnen diese „Kleinigkeit“ schon aufgefallen? Wenn nicht kommen Sie doch einmal vorbei und sehen es sich an.
Quelle:
Recherche Andreas Rauch, Markus Siefert, Wörrstadt-Rommersheim. Nicolai Knauer, Heilbronn

Burg“Einblicke“ – Scharwachttürmchen
Burg Lichtenberg wird im Westen – also auf der „Unterburg“ durch eine ca. 23 Meter breite und 6-7 Meter hohe Wehrmauer begrenzt.
An der nördlichen Ecke oben ist ein diagonal eingezogener kurzer Unterzug erkennbar. Dies deutet auf das vormalige Vorhandensein eines Scharwachttürmchens hin. Vermutlich wurden aber beide Enden der Mauer bei ihrem Bau im 14. Jahrhundert mit derartigen Bauwerken versehen, was die Burg noch imposanter erscheinen ließ. (1)
Aber was ist ein Scharwachttürmchen?
Ein Scharwachtturm (Échauguette, Pfefferbüchse, Hochwachtturm oder Horchhäuschen) ist ein kleiner Erkerturm auf einer Bastionsspitze, Mauer- oder Gebäudeecke, der einen runden oder vieleckigen Grundriss aufweist. Er steht meist auf einer Konsole und ist vorkragend. Seinen oberen Abschluss bildet entweder ein Dach oder eine zinnenbewehrte Plattform.
Scharwachttürme wurden erstmals im 12. Jahrhundert an mittelalterlichen Burgen ausgeführt und waren bis in das 16. Jahrhundert auch an Festungen gebräuchlich. In der Gotik traten sie zahlreich an so genannten Fünfknopftürmen auf. Später kamen Scharwachttürmchen nur noch als dekoratives Element zum Einsatz.
Ursprünglich dienten sie jedoch als Beobachtungspunkt für Wächter und besitzen deshalb immer Sichtöffnungen im Mauerwerk. Hinzu kommen häufig fortifikatorische Elemente wie Schießscharten und Maschikulis, während die Türme oft den Eckpunkt eines Wehrgangs bilden.
Eugène Viollet-le-Duc vermutete in seinem Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVe siècle, dass die frühen Scharwachttürme – ebenso wie die damaligen Hurden – komplett aus Holz bestanden und die ersten steinernen Exemplare ganz einfache Ecktürme mit rundem oder viereckigem Grundriss waren, die auf Ecken von Wehrmauern oder Wehrtürmen aufgesetzt waren (2).
Quellen:
Text und Recherche: Andreas Rauch, Burgverwaltung



















































































Die Zeiten ändern sich. Während heute Burgen oft als Stätte der Begegnung dienen und zur Besichtigung, zum Staunen und Innehalten einladen so sind sie doch urspünglich Bauwerke welche (auch) auf das Rückziehen und Verteidigen von Leib, Leben und Gut angelegt waren.
Und genau zu diesem Zweck wurden verschiedenste Vorrichtungen erfunden die ein ungewünschtes Betreten der Burg verhindern sollten. Eine solche Vorrichtung war die Senkscharte.
Eine Scharte wird zunächst als ein Einschnitt in Mauern oder Wehrgängen einer Burg definiert werden als Öffnung für Schusswaffen aller Art diente konnte.
Eine Art spezielle Art dieser Scharten ist die Senkscharte. Es handelt sich um eine Öffnung in einem Wehrgang welche sich nach unten öffnet und dazu diente einen Gegner zu bekämpfen der sich bereits nahe der Mauer befand oder um einen Eingang nochmals besonders zu sichern.
Die hierzu im unteren Bereich der Scharte nach außen hin abwärts geführte Neigung führt zu einer Verkleinerung des toten Winkels im Mauervorfeld bzw. am Mauerfuß.
Zwei schöne Beispiele hierfür befinden sich an der westlichen Wehrmauer der Oberburg. Dort befindet sich (neben der großen Zisterne) ein Durchlass in der Wehrmauer welcher (etwas schräg oberhalb) durch eine breitrechteckige Senkscharten in der Wehrmauer (Maße ca. 70 cm mal 60 cm) gesichert wird. Die Wehrmauer selbst erfährt durch eine sich nochmals weiter oben in dem Wehrgang befindliche Senkscharte (Maße ca. 60 auf 40 cm) eine zusätzliche Verteidigungsmöglichkeit.
Kleiner Hinweis: Die Treppe zu dem Durchlass stammt aus dem 20. Jahrhundert.
Quelle: Burgenlexikon Band III
Recherche und Text: Andreas Rauch, Burgverwaltung
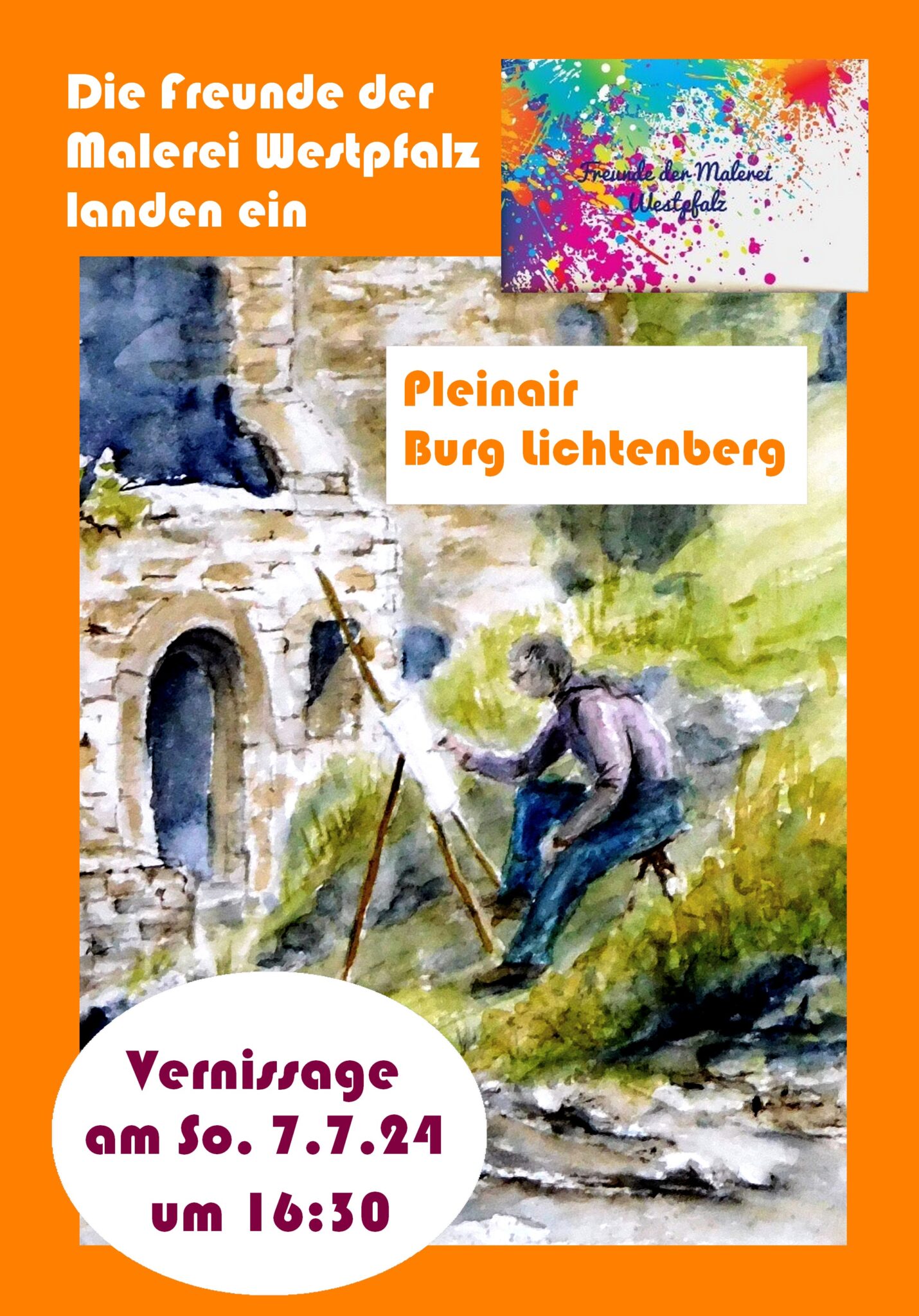
Am Samstag, den 15. und Sonntag, den 16.06.2024 fand auf der Burg Lichtenberg das Plein-Air-Mal-Event statt.
Etwa ein Dutzend Künstler beteiligten sich und arbeiteten eifrig daran, die Stimmung der Burg in Bildern einzufangen. Neben verschiedenen Maltechniken wurde auch Bildhauerei den interessierten Besuchern nähergebracht.
Die Vernissage, mit Vorstellung der dabei entstandenen Werke und der teilnehmenden Künstler, findet am Sonntag, dem 07.07.2024 um 16:30 Uhr auf dem Platz vor der Zehntscheune statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Räumlichkeiten der Zehntscheune verlegt.
Das Programm wird musikalisch begleitet von dem Saxophonist Udo Schultheiss.
Die Freunde der Malerei Westpfalz laden Sie herzlich zu diesem Event ein und freuen sich, Sie begrüßen zu dürfen.
In der Zeit vom 08.07. – 01.08.2024 findet dann im Anschluss an die Vernissage im Kammer-musikraum im 3. OG der Zehntscheune die Ausstellung statt, in der alle Kunstwerke noch einmal in Ruhe besichtigt werden können.