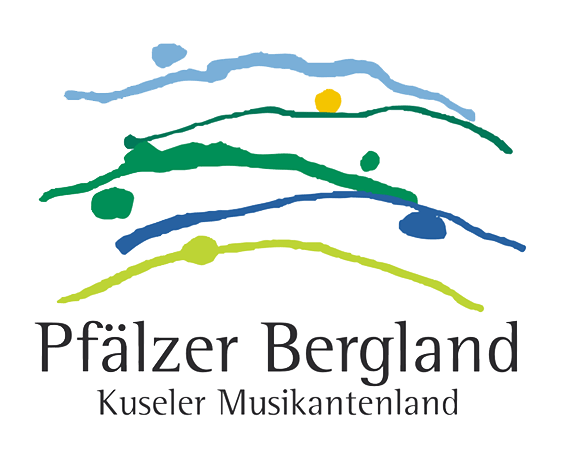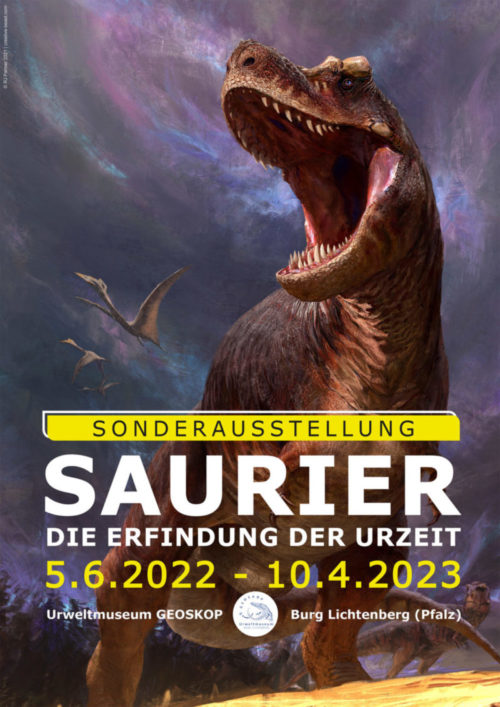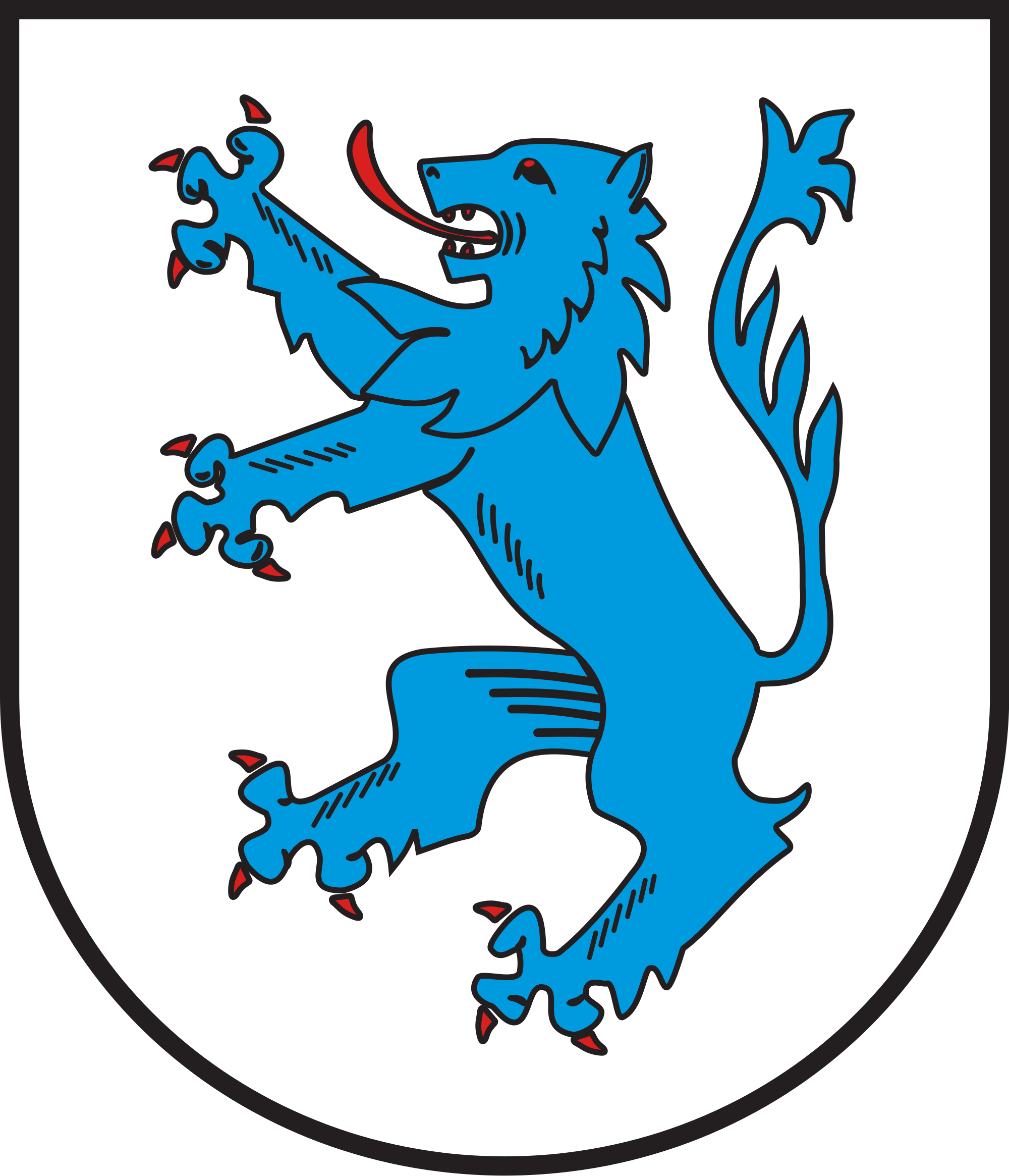In der veldenz‘ischen Zeit der Burg 1214-1444 finden sich unter den Burgmannen auffallend viele Träger eines Wappens mit 2 waagrechten Querbalken, von denen der obere mit 3, der untere mit 2 Kugeln belegt ist.
Dieses Wappen kann als echtes Lichtenberger Burgmannenwappen gelten, die Träger waren nachweislich auch untereinander verwandt. Durch die Farben, die nicht mehr alle bekannt sind, dürften sich die Wappen der einzelnen Familien voneinander unterschieden haben.
Zur Anschauung verwenden wir das Wappen derer von Esch (Burgmannen im 14. und 15. Jahrhundert) Hier wurde erstmalige die Wappenfarbe beschrieben – unklar ist allerdings die Farbe der Kugeln: schwarz oder gelb.
Übrigens: Im Wappen der Gemeinde Thallichtenberg zu der Burg Lichtenberg gehört finden sich heute noch die Balken und fünf Kugeln.
Bornbach von Lichtenberg
Vielseitig waren die Bornbach von Lichtenberg – sie standen in veldenzischen, sponheimer und kurtrierischen Lehndiensten.
Der erste der aus dem Geschlecht genannt wird ist Ritter Wilhelm genannt Bornebach.
1288 ist er an der Festlegung des Wittums (Witwensitz) für Agnes von Leiningen beteiligt.
1303 ist er Zeuge in einer Urkunde bei der Heirat zwischen Johann II von Sponheim-Kreuznach und Wildgräfin Susanna von Kyrburg.
Als zweiter ist Klaus I bekannt:
1343 hat er als Edelknecht von Lichtenberg mit seiner Frau Katharina ein Burglehen zu Lichtenberg
1354 einigt er sich mit Godelmann Finchel (Edelknecht zu Lichtenberg) bezüglich eines Zehnten zu Wieselnbach.
Von Klaus dem I. ist ein Sohn Klaus II. bekannt
1371 schließt dieser mit 15! Weiteren Burgmannen von Lichtenberg mitten im kalten Winter mit dem Grafen von Veldenz einen Burgfrieden ab.
Klaus II. hinterläßt zwei Söhne, Klaus III. und Jeckel.
1393 verbürgt sich ein Eberhard von Sötern für Jeckel Bornbach von Lichtenberg
1416 wird Jeckel mit vielen anderen Adligen zu einem Mannentag nach Meisenheim geladen.
1420 söhnt sich Jeckel wegen mehreren Streitigkeiten mit dem Grafen von Veldenz aus und es ist belegt, dass Jeckel ein Haus auf Burg Lichtenberg hat
Die Familie stand jedoch nicht nur in veldenzischen sondern auch in Sponheimer und kurtrierischen Diensten
Sponheim
1389 söhnte sich Jeckel Bornbach von Lichtenberg mit Graf Simon von Sponheim-Vianden aus und verpflichtete sich und seine Erben dem Grafen für 10 Gulden jährlich
1390 Klaus III. und Jeckel erhalten von Graf Johannes III. von Sponheim Wein als Mannlehen (Lehen gegen Heerfolge).
Kurtrier
Hier ist Nikolaus Bornbach zu nennen
1347 wirbt Erzbischof Balduin von Trier „gegen Ludwig, der sich Kaiser nennt“
1351 bestätigt er den Erhalt von Manngeld
Aber auch der bereits erwähnte Jeckel lässt sich in kurtrierischen Diensten gut belegen
1380 schwört er Urfehde (durch Eid bekräftigter Verzicht auf Rache und auf weitere Kampfhandlungen) wegen seinem Streit mit der Stadt Trier
1386 verzichtet er auf Manngeld und bekommt als Gegenleistung ein Gut zurück
1390 ist er kurtrierischer Amtmann zu Kastel auf der Blies
1401 gibt ihm der Erzbischof von Trier das Amt Liebenberg bei St. Wendel
Dies sind nur kleine Ausschnitte aus fernen Zeiten welche von dem Wirken der Menschen, die heute fast vergessen sind, zeugen.
Quelle:
Haarbeck: Die Grafen von Veldenz und ihre Burgmannen auf Lichtenberg 1214 – 1444
Text: Andreas Rauch